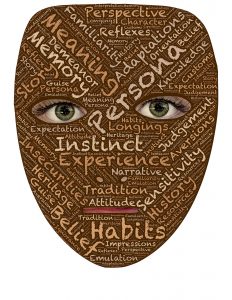Der Kulturanthropologe Ralph Linton legte in seinem 1936 erschienenen Werk „The Study of Man“ die Grundlage der soziologischen Rollentheorie. Darin erarbeitete er eine Unterscheidung zwischen Sozialem Status und Sozialer Rolle. Während der Status die Position eines Individuums in einem kulturell bestimmten Muster sei und mit bestimmten Rechten und Pflichten einhergeht, versteht Linton die Rolle als die individuelle Ausfüllungsart dieser Position. Er bringt seine Begriffsbestimmung auf den Punkt, wenn er die Rolle als „Gesamtheit von kulturellen Mustern, die mit einem bestimmten Status verbunden sind“, definiert. (Wiswede 1977)
Daraus folgt, dass das Funktionieren der Gesellschaft über bestimmte Rollen gewährleistet ist. Würden wir nicht bestimmte Rollen übernehmen, würde dem gesellschaftlichen Miteinander Verlässlichkeit fehlen. Rollen manifestieren sich in bestimmten Verhaltensweisen eines Menschen in einem bestimmten Kontext. Es geht dabei um Wertevorstellungen, Einstellungen und Reaktionen. Sie dienen einer befriedigenden Kommunikation und Verständigung, aber auch der Zuordnung von Identität. Im gesellschaftlichen Kontext entsteht Identität, wenn der Einzelne an ihn herangetragene kulturelle Annahmen zur Grundlage seines Handelns nimmt bzw. daraus ein Selbstbild ableitet. Identität lässt einen Menschen sich als räumlich und zeitlich unabhängig dieselbe Person erfahren. Sie schafft innere Kontinuität und Kohärenz.
Eine Rolle ergibt sich aber nicht nur aus dem inneren Selbstverständnis eines Individuums. Vielmehr stellt die Gesellschaft diverse Erwartungen an den Inhaber einer Rolle. Der Soziologe Ralf Dahrendorf konzipierte ein Rollenmodell, nach dem der Mensch als durch bestimmte Normen und Werte, die an seine Rolle geknüpft sind, bedingt wird. Er unterscheidet drei Varianten von Erwartungen: Muss-Erwartungen werden als allgemeines Gesetz angesehen und Zuwiderhandlung mit negativen Sanktionen bestraft. Soll-Erwartungen sind konventionelle Vorstellungen, wie ein Individuum in einer Rolle sich darzustellen habe. Kann-Erwartungen entsprechen einem idealtypischen Verhalten und werden mit positiven Sanktionen belegt. (vgl. Dahrendorf 1970)
Wenn jemand seiner Rollenerwartung entsprechend handelt, wird er als zuverlässig angesehen. Seine Reaktion ist dann antizipierbar. Jedoch sind in der heutigen Zeit Rollenbilder offener und weniger fest abgesteckt denn je. In diesem Zusammenhang kann man eine ältere traditionelle Rollentheorie von einer revidierten Rollentheorie unterscheiden. In der traditionellen Rollentheorie geht es darum, fest definierte Rollen im Sinne einer reibungslosen Anpassung an herrschende Verhältnisse anzunehmen. Es geht also um Erlernen von konformen Verhalten. Dieses Rollenkonzept bietet kaum Raum für Spontaneität, Kreativität und Individualität. Außerdem wird die traditionelle Rollentheorie nicht dem subjektiven Pluralismus unserer Existenz gerecht. Menschen übernehmen verschiedene Rollen und verschiedene Verhaltensweisen, je nachdem, in welchem sozialen Kontext sie sich gerade befinden. Infolge der Vielfalt von Positionen in unserer Gesellschaft werden unterschiedliche, gegebenenfalls sogar widersprüchliche Erwartungen an ein Individuum und seine Rollen gestellt.
Das ist der Ausgangspunkt einer revidierten Rollentheorie, die für zeitgenössische Theaterpädagogik grundlegend ist. Sie erwartet nicht, dass alle Akteure ihr Handeln den Normen getreu ausüben. Vielmehr unterstützt sie eine autonomere Ich-Organisation. Mit den an ein Individuum herangetragenen Rollenerwartungen kann sich kritisch reflektierend auseinandergesetzt werden. Sie fördert eine kreative und selbstbestimmte Ausfüllung und Weiterentwicklung der zu übernehmenden Rolle. Die Rolle wird zu einem interaktiven Dialog mit den Erwartungen, dessen Ausgang offen ist. Die Reaktion des Rolleninhabers wird also nicht a priori durch eine unveränderliche Erwartung vorgegeben, sondern gestaltet sich im spontanen Augenblick aus den individuellen Prägungen, dem spezifischen Kontext und einer relativen Rollendefinition. Aufgrund der offenen Dynamik wird auch soziale Kompetenz gestärkt. Es geht darum, auch in nicht vorherzusehende Interaktionen zu treten und autonom zu handeln.
In diesem Sinne wird die revidierte Rollentheorie dem Prozess einer postmodernen Identitätsbildung gerecht. Je zahlreicher und unterschiedlicher die Erwartungen sind, die an uns gerichtet werden, desto mehr wird die Herstellung von Identität zu einem Balanceakt. Identität ist unter solchen Bedingungen kein fester Zustand und kein Resultat, auf das man hinarbeiten und mit dem man sich zufriedenstellen kann. Vielmehr wird sie durch Erzählungen generiert, die wir an jeweilige Rollen knüpfen. Dabei geschieht eine permanente Pendelbewegung zwischen Rollenübernahme und Selbsterfindung. Identität kann somit als ein entgrenzter Prozess einer narrativen Konstruktion verstanden werden. (vgl. Kraus 1996)
Abels, Heinz: Identität. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010
.

Kraus, Wolfgang: Das erzählte Selbst. Die narrative Konstruktion von Identität in der Spätmoderne. Pfaffenweiler 1996.

Linton, Ralph: The Study of Man. Appleton-Century-Crofts, New York 1936.